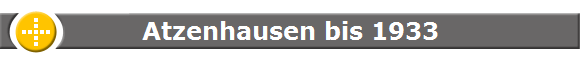
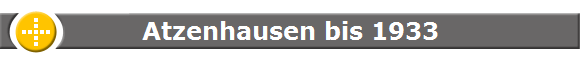 |
|
Atzenhausen Kurz vor dem Zweiten Weltkriege wurde auf der Feldmark eine vorgeschichtliche Spitzhacke gefunden, die deshalb besonderes Interesse erregte, weil ihre Machart Zweifel offen ließ, ob sie noch in der Mittleren oder schon in der Jüngeren Steinzeit hergestellt worden war. Wie bei allen Einzelfunden lag die Vermutung nahe, dass ein schweifender Jäger und Sammler diese Hacke vor etwa 10000 Jahren verloren habe (1). Sie beweist aber, dass die Gemarkung Atzenhausen damals schon Menschen Nahrung bieten konnte. Als 1980 die Thiebergstraße bebaut wurde, stieß man auf Reste eines frühmittelalterlichen Grubenhauses, das höchstwahrscheinlich um die Wende des 9. zum 10. Jahrhundert errichtet wurde (la). Bei diesen lag der Wohnraum unter dem Erdboden, so dass nur das Dach oberirdisch gebaut wurde. Die Einstiegsluke diente gleichzeitig als Fenster und als Rauchabzug. Grubenhäuser wurden bis in unsere Zeit in Kanada, Alaska und Sibirien benutzt. Da unsere Vorfahren ebenso wie die Völker des nördlichen Asien und Amerika keine Öfen kannten, benötigten sie Hausformen, die zur Erhaltung der Wärme des Herdfeuers besonders geeignet waren. Dämmerlicht und ein für unsere Nasen unerträglicher Geruch mussten als nebensächlich ertragen werden. Der Fund des Grubenhauses ermöglicht uns das Alter Atzenhausens um etwa 100 Jahre früher als bisher üblich zu datieren. Der Mündener Chronist Lotze schrieb, Kaiser Otto III. habe Atzenhausen 990 dem Kloster Hilwartshausen geschenkt, ohne hierfür freilich einen sicheren Beweis zu erbringen (2). Unmöglich wäre es allerdings nicht, denn jene Abtei hatte in der Gegend einen beachtlichen Grundbesitz. Im Jahre 1370 musste Herzog Otto der Quade, der das damalige welfische Fürstentum Göttingen regierte, die Brackenburg samt ihrem Zubehör verpfänden (3). Hierzu gehörte auch Atzenhausen. Der Historiker Sudendorf fügte die Erläuterung hinzu, das Dorf habe vermutlich seit der Erbteilung der Söhne Herzog Albrechts des Langen im Jahre 1286 zum Gericht der Burg Brackenburg gehört (4). Aus den Burg- und Gerichtsrechten entstand, als eine landesherrliche Verwaltung geschaffen wurde, das Amt Brackenberg, dem Atzenhausen bis ins 19. Jahrhundert zugehörte. Deshalb hat Atzenhausen bis zum Jahre 1852 eine geschichtliche Entwicklung durchlaufen, die von der aller anderen Ortsteile verschieden ist, ganz davon zu schweigen, dass die historischen Beziehungen des Dorfes zu Hann.-Münden und Friedland stärker waren als die zu Göttingen und Rosdorf. Durch die etwas abseitige Lage des Dorfes konnte hier ein Geschlecht der Herren von Atzenhausen emporsteigen. Es war nicht ritterbürtig, sondern kam aus der Schicht der Dienstmannen, der Ministerialen, die aus bäuerlichen Familien stammten, sich auf eigene Kosten bewaffnen, kleiden und beritten machen konnten und so als Berufskrieger Dienste bei einem der großen Territorialherren nahmen. Sie erhielten als Entgelt für gewöhnlich ein Lehen, das sie natürlich zu vermehren trachteten. Eine große Anzahl mittelalterlicher Adelsgeschlechter sind auf diese Weise entstanden, einige stiegen allmählich bis zu Reichsfürsten auf. Im Jahre 1359 wird ein Hermann von Atzenhausen urkundlich genannt, dem Erzbischof Gerlach von Mainz zum Ersatz von Verlusten, die er in den Diensten seiner Amtsvorgänger erlitten hat, 40 Mark Heiligenstädter Währung zusagte, die aus den Einkünften von Heiligenstadt in vier Raten zu je zehn Mark binnen vier Jahren ausgezahlt werden sollten (5). Die Urkunde gibt interessante Aufschlüsse. Da Hermann von Atzenhausen mehreren Erzbischöfen von Mainz gedient hat, muss er etwa 60 Jahre alt gewesen sein. Sein Geschlecht wird also höchstwahrscheinlich schon am Ende des 13.Jahrhunderts bestanden haben, was wiederum bedeutet, dass Atzenhausen älter ist, als es die ältesten erhaltenen Urkunden nachweisen. Die Summe von 40 Mark bedeutete damals ein Vermögen, denn für eine Mark konnte man in Göttingen einen Ochsen kaufen (6). Aus diesem Grunde vermochte sie auch Heiligenstadt nicht auf einmal zu zahlen, da aus den erzbischöflichen Einkünften auch noch andere Ausgaben zu begleichen waren. Hermann war also ein wohlhabender Mann. Im Jahre 1384 belehnte Graf Hermann von Everstein Hans von Berlepsch mit drei Hufen in Mengershausen, offensichtlich eine Wiederbelehnung, denn unter den Afterlehnsträgern, an die also der damit Bedachte die Nutzungsrechte weitergab, befindet sich ein Hermann von Atzenhausen. Es ist möglich, dar es sich um einen Sohn des oben genannten gleichnamigen Dienstmannen handelte. Diese Urkunde zeigt die engen Beziehungen Atzenhausens zu den Herren von Berlepsch auf, die Jahrhunderte hindurch bestanden haben, aber auch die ersten nachweisbaren zu einem anderen Ortsteil Rosdorfs. Die Herren von Atzenhausen haben also ihren Besitz nach Möglichkeit ausgedehnt und mussten deshalb Lehen von mehreren Herren nehmen, was damals allgemein üblich war (7). Im Jahre 1426 schenkte der Knappe Hans von Atzenhausen 23 Morgen und eine Wiese, die am Wege zwischen Atzenhausen und der Burg Berlepsch lagen, dem Kloster Mariengarten zum Seelenheil seiner Eltern und eines erschlagenen Angehörigen. Gleichzeitig verkaufte er dem Kloster die Herbstbede (eine Steuer) über vier Hufen, d.h. 120 Morgen, die einen halben Ferding, das war der achte Teil einer Mark, und zwei Hühner betrug und Dienstleistungen, die auf diesen Hufen ruhten und zu einem Lot gerechnet wurden, d.h. dem sechzehnten Teil einer Mark, für sechs Mark. Die vier Hufen lagen in Kohagen, einem damals schon verlassenen Dorf bei Barlissen. Die Urkunde bemerkt, dass diese Hufen eben Tyle Herzog bewirtschaftete (8). Hans von Atzenhausen hatte also selbst schon wieder Lehnsleute. Der gleiche Knappe wird in einer anderen Urkunde des Jahres 1426 als Amtmann von Friedland bezeichnet. Er hat also zu denen gehört, die eine landesherrliche Verwaltung, mochte sie im Mittelalter auch noch sehr locker sein, aufbauen halfen. Das herzogliche Amt Friedland ist eine der Keimzellen gewesen, aus der der Landkreis Göttingen erwachsen ist. Die Urkunde dokumentiert einen Tausch, in dem er zeit seines Lebens sein Vorwerk in Atzenhausen gegen den halben Zehnt von Gertenbach, dem Kloster Mariengarten überließ. Der Zehnt von Atzenhausen blieb dabei aber, was ausdrücklich betont wurde, in seinem Besitz (9). Bald danach begannen sich die Herren von Boventen für Atzenhausen zu interessieren und konnten 1439 von Herzog Otto Cocles (d.h. dem Einäugigen) von Braunschweig Güter in Atzenhausen zu Lehen. nehmen (10). In den nächsten Jahren bauten sie ihre Stellung weiter aus. Zwischen 1460 und 1470 erscheinen die Berlepsch als Lehnträger der Herren von Boventen in Atzenhausen, wo sie ein Vorwerk, den halben Zehnten und den halben Zehnten zum Rode, dem heutigen Flurstück Braunsröder Feld südlich des Dorfes von diesen hatten (11). Diese Grundstücke und Rechte gehörten zur Ausstattung der Burg Jühnde (12). Ferner besaßen die Herren von Boventen 1460 den Zehnten zu Alperode, den als Afterlehen die Herren von Atzenhausen innehatten. An dieses schon im Mittelalter verlassene Dorf erinnert noch der Flurname Alpenröder oder Erperöder Feld am Fuße des Steinberges bei Barlissen (13). Da die Steuern und sonstigen Verpflichtungen, die auf dem Orte ruhten, auf Atzenhausen übergingen, ist als sicher anzunehmen, dass die Bewohner nach Atzenhausen zogen und von dort aus ihre Felder bewirtschafteten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die in Hann.-Münden im 15. und 16.Jahrhundert nachweisbare Patrizierfamilie von Alperode aus dem aufgelassenen Dorf stammte (14). Ein undatiertes Lehnsregister der Herren von Boventen führt unter ihren Lehnsträgern Cord Ridder in Atzenhausen auf, sicher ein Mitglied der nunmehr in den Ritterstand aufgestiegenen Herren von Atzenhausen. Dieser hatte von den Herren von Boventen zwei Hufen zu Lehen (15). Ein weites Lehnsregister der Herren von Boventen und des Hans von Jühnde stellt fest, daß um 1480 diese vom Erzbistum Mainz den Zehnten von Atzenhausen und vier Hufen Landes zu Lehen hätten, welche sämtlich die Herren n Atzenhausen von ihnen als Afterlehen bekommen hätten (16). Es scheint sich hier um den gleichen Zehnten und die Grundstücke zu handeln, die schon ein halbes Jahrhundert früher im Besitz der von Atzenhausen gewesen sind. Nach einem Lehnsregister des Hans von Boventen aus dem Jahre 1487 saßen die von Atzenhausen eine halbe Hufe und den halben Zehnten zu Mengershausen (17). Wann die Steuer in ihre Hände kam, wissen wir nicht, halbe Hufe oder 15 Morgen dürften aber die gleichen Grundstück gewesen sein, um die Hermann von Atzenhausen 1384 bat. Kurz darauf fielen die Boventschen Güter an die Herren von Adelebsen und kamen als geschlossene Gütermasse 1664 an deren Rechtsnachfolger, die Freiherren von Grote zu Jühnde (18). Die Lehen der Boventen in Atzenhausen machten diese Entwicklung mit. Für das Jahr 1480 ist für das Dorf ein bäuerlicher Lehnsträger nachweisbar, ??? Hovemester, der eine Hufe bewirtschaftete und für sie jährlich eine halbe Mark an Abgaben zu zahlen hatte (19). |
|
In den folgenden Jahrhunderten traten überall bürgerliche Lehen stärker in den Vordergrund, auch in Atzenhausen. So erhielt die Göttinger Familie Bode einen ausgedehnten Besitz, zu dem 1536 in Atzenhausen ein Vorwerk und der halbe Zehnt des Dorfes gehörten, die beide von Braunschweig-Lüneburg zu Lehen gingen (20). Das 16.Jahrhundert verlief in Atzenhausen ruhig. Um so schwerer war das folgende. Der Dreißigjährige Krieg, der von 1618-48 in Deutschland tobte, hinterließ auch im Göttinger Raum blutige Spuren. Zwar begann der Krieg weit von Niedersachsen entfernt in Böhmen, aber Deutschland wurde gleichzeitig von einer Wirtschaftskatastrophe größten Aussmaßes heimgesucht, der ersten Inflation, die unter dem Namen Kipper- und Wipperzeit bekannt ist. Im südlichen Niedersachsen verlor die Bevölkerung 90% ihrer Ersparnisse. Das wäre freilich bei weitem nicht so schlimm gewesen, wie es später in der Inflation von 1923 werden sollte. Wir müssen aber bedenken, dass der Währungsverfall, der nach dem verlorenen Weltkriege von 1914-18 einsetzte und 1923 seinen Höhepunkt erreichte, eine Folgeerscheinung des großen Ringens war, während die Kipper- und Wipperzeit von 1619-2l am Beginn eines Krieges stand, der noch 27 Jahre dauern sollte (21). Für das südliche Niedersachsen wurde die Lage durch eine Naturkatastrophe verschlimmert. Am ersten Pfingsttag des Jahres 1620 vernichtete ein Hagelunwetter größten Ausmaßes den Getreidewuchs, so dass nur eine spärliche Ernte eingebracht werden konnte (22). Eine Teuerung war die Folge, die natürlich durch die gleichzeitige Geldentwertung noch verschlimmert wurde. Gleichzeitig setzte aber auch die starke Belegung des Göttinger Raumes mit Truppen ein, die zum Kriegsschauplatz marschieren sollten (23). Bereits am 19. Juni 1627 musste die Stadt Göttingen berichten, dass alle Dörfer des Umlandes durch Plünderungen und Kriegsleistungen völlig erschöpft seien (24). Eine Viehzählung ergab, dass im gesamten Amt Brackenberg nicht ein Pferd, keine Kuh und kein Schwein mehr vorhanden war (25). Die Bauern spannten sich selbst vor die Pflüge. Die steuerlichen Anforderungen wurden ständig höher. Die Kontribution von 1632 erbrachte nur wenige Taler, denn die Bevölkerung besaß nichts mehr (26). Atzenhausen trug selbstverständlich seinen Anteil an den Lasten, die dem Amt Brackenberg auferlegt wurden und wurde allmählich völlig ausgeplündert. Schlimm wurde es zum Schluss des Krieges, denn das im Göttinger Raum stehende hannoversche Militär musste vollständig auf den Dörfern einquartiert werden, weil die Stadt zu Zweidritteln zerstört war (27). Unglücklicherweise litt Atzenhausen besonders, weil die zurückmarschierenden kaiserlichen Truppen natürlich die Brücken von Witzenhausen und Hann.-Münden benutzen mussten, was die Einquartierungslasten noch weiter vermehrte. Wie stark der Dreißigjährige Krieg im Gedächtnis blieb, beweist ein interessanter Vorfall. Beim Ausschachten eines Brunnens wurde 1926 ein Skelett gefunden. Da hier früher kein Friedhof bestanden hatte, vermuteten die Atzenhäuser sofort, es handle sich um die Überreste eines im Dreißigjährigen Krieg Umgekommenen (28). Bei den unzähligen Gewalttaten jenes Ringens lag der Gedanke zwar nicht fern, er beweist aber, daß die Ereignisse der folgenden Kriege in Vergessenheit geraten waren. Im Siebenjährigen Kriege schrieben die Franzosen ungeheure Geld- und Sachleistungen aus. So musste das Fürstentum Göttingen in der ersten Kontribution, der noch zwei andere folgten, 550 000 Taler, 1,5 Millionen Rationen, die Ration ist die Tagesverpflegung eines Militärpferdes, sowie für jeden der Besatzungssoldaten ein Paar Stiefel und ein Gilet, eine warme Interziehweste, liefern (29). Da das gesamte Fürstentum Göttingen damals kaum 60 000 Einwohner hatte und das Pferdefutter und Stroh natürlich von den Landwirten geliefert werden musste, kann man sich vorstellen, welche Lasten auf die Bevölkerung zukamen, denn die üblichen Abgaben liefen daneben ja weiter. Als Göttingen eine ständige französische Besatzung bekam, musste das Amt Brackenberg zu deren Unterhaltung beitragen. Für die Gemeinden bedeutete dieses eine erhebliche zusätzliche Belastung. Das Geld musste nämlich in hannoverscher Währung eingezogen, aber in französischer abgerechnet werden. Auf das Amt Brackenberg entfielen z.B. im Februar 1760 810 Livres, was in hannoverschem Gelde etwa 540 Taler ausmachte (30). Hiervon hatte Atzenhausen mindestens 100 aufzubringen. Eine Katastrophe trat im Oktober 1760 ein. Eine aus Franzosen und Sachsen bestehende Truppenabteilung von 8.000-10.000 Mann bezog ein Lager bei Deiderode (31). Auch Atzenhausen musste erhebliche Mengen an Brot, Getreide, Pferdefutter und Lagerstroh liefern und Gespanne für Militärfuhren aller Art stellen. Hierbei traten derartige Verluste an Zugvieh und Tagen auf, dass im Herbst die Felder nicht bestellt und im Winter aus den Wäldern kein Holz gefahren werden konnte. An Lebens- und Futtermitteln trat nicht nur in Atzenhausen und den umliegenden Dörfern sondern selbst in Göttingen, das ja auf Zufuhren vom ende angewiesen war, ein fühlbarer Mangel ein (32). Erst am 20.November 1760, als es für die Wintersaat zu spät war, wurde das Lager bei Deiderode geräumt (33). Ungeachtet dieser besonderen Belastung musste Atzenhausen im Rahmen des Amtes Brackenberg zum Unterhalt der in Göttingen zurückgebliebenen französischen Besatzung beitragen (34). Es konnten von den erschöpften Dörflern nur noch drei Viertel der geforderten Summe, nämlich 1215 Livres, aufgebracht werden. Atzenhausen gehörte damit zu den Orten, die den höchsten Restbestand aufzuweisen hatten (35). Neue Forderungen machten die Erfüllung der alten unmöglich. Die Unterhaltsleistungen wurden im Jahre 1761 nämlich verdreifacht (36). Gleichzeitig sollte das Fürstentum Göttingen noch 9 000 Malter Korn für die französische Armeebäckerei liefern (37). Atzenhausen konnte hierzu selbstverständlich nichts beitragen. Dagegen konnten vom Dorf 35 Ellen Leinwand, die für die französischen Lazarette in Göttingen benötigt wurden, aufgebracht werden (38). Da Atzenhausen kaum noch in der Lage war, Lieferungen irgendwelchen Art zu leisten, mussten die Bewohner ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen und in den Wäldern des Amtes Brackenberg Bau- und Brennholz für die französischen Besatzungstruppen in Göttingen schlagen (39). Ungeachtet dieser Verpflichtungen versuchten die Bauern wenigstens einige Felder mit Sommersaat zu bestellen, mussten von den bescheidenen Erträgen aber wieder ihren Anteil zur Auffüllung des französischen Magazins geben (40). Auch im Sommer 1762 erfolgten noch einige Lieferungen (41). Dann ging der Krieg dem Ende zu und die Bevölkerung konnte an die Aufbauarbeit gehen. In den Revolutionskriegen gegen Frankreich fielen 1793-95 drei Atzenhäuser, der Sergeant Carl Utermöhlen und die Soldaten Christian Kleinhans und J.. Steinmetz (41a). Im Jahre 1800 wurden einige Ortschaften des Göttinger Raumes durch ein schweres Hagelunwetter heimgesucht, von dem Atzenhausen besonders schwer betroffen wurde. Die Bäume wurden durch den Hagel völlig entlaubt, die Früchte und auch Äste heruntergeschlagen. Die Feldfrucht wurde vernichtet (42). Das Dorf hatte diesen wirtschaftlichen Schlag noch nicht überwunden, als im Jahre 1803 die Armee Napoleons Hannover besetzte. Zwei Atzenhäuser, Justus Kapmann und Fritz Suchert, schlossen sich der englisch-deutsehen Legion an und kämpften in Spanien in der Armee Wellingtons. Beide kehrten 1815 schwer kriegsversehrt in die Heimat zurück. Suchert hatte in England den Beruf des Kochs ergriffen und eröffnete in Atzenhausen eine Speisewirtschaft (43). Dadurch wurde das ziemlich abgelegene Dorf zu einem Ausflugsziel. Natürlich ahnte der alte Soldat nicht, dass er damit für seinen Heimatort die erste Grundlage schuf, auf der die spätere Entwicklung zum Erholungsgebiet beruhte. In den napoleonischen Kriegen litt Atzenhausen bei weitem nicht so schwer wie in den früheren, weil die Etappeninspektionen die Marschrouten der Truppen so legten, dass die Ortschaften gleichmäßig belastet wurden. Da Göttingen zum Königreich Westphalen gehörte, betrachtete man es als Freundesland und alle Leistungen für das Militär wurden binnen vier Wochen gezahlt. Im Juni 1807 lagen spanische Kavalleristen im Quartier (44). Wesentlich unheimlicher waren schwer beladenene Munitionskolonnen, die nach dem Brauche der französischen Armee grundsätzlich Nebenstraßen benutzen mussten und meist nachts fuhren. Das Schwarzpulver konnte sehr leicht explodieren. Leider lag Atzenhausen an einer Nebenstraße und jeder Bewohner atmete auf, wenn eine solche Kolonne das Dorf glücklich passiert. Besonders häufig kamen im März 1813 Munitionswagen durch Atzenhausen (45). Leider hatte Atzenhausen auch einen Verlust zu beklagen. Der Musketier Christoph Müller musste in den Reihen der westphälischen Armee 12 nach Rußland marschieren und und ist dort verschollen. Vermutlich ist er während des Rückzuges erfroren (46). Im März 1813 begann die Neuaufstellung der Armee. Überall wurden Pferdemusterungen abgehalten (47). Die Einquartierungen häuften sich und eine Sondersteuer von 100000 Francs wurde auf die Stadt Göttingen und umliegenden Dörfer aufgeschlüsselt (48). Zum Glück blieb Atzenhausen von den Kampfhandlungen der Befreiungskriege verschont. Nach dem Friedensschluss wurde die Ruhe nicht gestört. Die Verwaltungsreform von 1852 brachte den Zusammenschluss der Ämter Friedland und Brackenberg, aber bereits 1859 wurde das Amt Friedland mit dem in Reinhausen vereinigt. Damit endete die bislang verhältnismäßig selbständige Entwicklung Atzenhausens. Der Bearbeiter der Akten muss das Urteil fällen, dass die Eingliederung Atzenhausens in das kaum lebensfähige Amt Brackenberg eine denkbar günstige Lösung gewesen ist. Der Ort konnte erst aufblühen, als er zum größeren und wirtschaftlich gesunden Amt Reinhausen kam. |
|||
|
Als das Königreich Hannover nach dem Kriege von 1866 aufgelöst und zur preußischen Provinz gemacht wurde, begann die Frage einer Verwaltungsreform in den Vordergrund zu treten. Sicher war, dass Göttingen der Sitz des neuen Landkreises werden würde, zwecklos also, die sowieso noch jungen Beziehungen Atzenhausens zu Reinhausen zu stark auszubauen. Zum Glück waren die Schwierigkeiten bei der Zusammenlegung der hannoverschen Ämter zu Landkreisen preußischer Art so groß, dass nur schrittweise vorgegangen werden konnte. Sonst wäre die Lage für Atzenhausen, das jahrhundertelang zum Amt Brackenberg gehört hatte, sehr schwierig worden, denn das kleine Dorf wurde in 20 Jahren viermal von einer Gemeindereform betroffen. Niemand bestritt seine Rechte, aber alle ruhenden oder ausgeübten Rechte und Pflichten und alle damit verbunden Guthaben und Forderungen mussten 1852 von Brackenberg auf Friedland von dort 1859 auf Reinhausen und von da wiederum auf den Landkreis übertragen werden. Die damit verbundenen Schwierigkeiten waren er derart verwickelt und vielschichtig, dass zwar 1885 der Landkreis Göttingen entstand, aber eine Reihe von Aufgaben der Ämter bis 1932 von den weiterbestehenden Amtsverbänden betreut wurden und erst dann auf den Landkreis übergingen. Nur auf diese Weise war es möglich, Ortschaften wie Atzenhausen, die zu anderen kommunalen Verbänden gehört hatten, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Besonders deutlich sieht man dieses Problem beim Landstraßenbau. Im Königreich Hannover hatte es den Wegeverband auf der Amtsebene gegeben. Die Heerstraßen oder Chausseen, die heute durchweg Bundesstraßen sind, wurden grundsätzlich von der Landesregierung geplant, technisch entworfen und durchgeführt, wobei die Ämter finanziell und durch die Stellung von Arbeitskräften herangezogen wurden. Die Verbindungen neben den Orten blieben Wege des Amtsverbandes und waren nach heutigen Begriffen befestigte Feldwege, die allmählich zu Kreisstraßen ausgebaut wurden. Bis 1914 wurden die Überschüsse der Sparkassen der vormaligen Ämter Reinhausen und Göttingen ausschließlich für den Kreisstraßenbau verwendet. Insgesamt handelte es sich um 650000 Goldmark, für damalige Verhältnisse eine beachtliche Hilfe (49). Wie gering die Steuerkraft Atzenhausens war, beweist die Tatsache, dass es als Wegebaubeitrag im Rechnungsjahr 1885/86 an die Wegebaukasse des vormaligen Amtes Reinhausen 231,41 Mark abführte und das war bis zum Ende des Jahrhunderts der Höchste (50). Der Niedrigste wurde im Etatjahr 1894/95 mit 157,13 Mark gezahlt (51). Die der Gemeinde zur Verfügung stehenden Steuer- und sonstigen Einnahmen waren so gering, dass sie bis 1945 die 4000-Mark-Grenze selten erreichten oder etwas überschritten, weshalb nur die dringendsten Aufgaben im Gemeindebereich erfüllt werden konnten. Das Hauptproblem der Gemeindeverwaltung sollte für Jahrzehnte die Wasserversorgung werden. Während eines schweren Gewitters fuhr im Juli 1884 ein Blitz in eine am Dorfbrunnen neben dem Teich stehende Pappel. Wie man später feststellte, verschüttete die geballte elektrische Energie des Blitzes die Brunnenquelle (52). Es wurde daher notwendig, ein neues Wasserreservoir aufzuschließen, da sich die Reparatur des Brunnens als unmöglich erwies und der Dorfteich kein Trinkwasser liefern konnte. Im Jahre 1902 wurde beschlossen, eine Bergquelle zu erschließen, eine Wasserleitung ins Dorf zu führen und hier ein Sammelbecken zu bauen. Die ganze Anlage sollte 9.000 Goldmark kosten (53). Leider genügte die gewonnene Wassermenge nicht, um den Bedarf zu decken. Deshalb wurde 1905 der Plan ausgearbeitet, eine Gemeindewasserleitung mit Hilfe der im unteren Dorf befindlichen Quellen anzulegen (54). Der Bau wurde durchgeführt und schuf für zwei Jahrzehnte Abhilfe. Der Weltkrieg brachte alle weiteren Projekte ins Stocken. Wie in alten Zeiten wurde am 2. August 1914 die Mobilmachung auf dem Thie verkündet (55). Während des großen Ringens konnte an eine Verbesserung der Wasserversorgung nicht gedacht werden. Dagegen war es möglich, Lichtleitungen legen zu lassen. Infolge der Knappheit an Arbeitskräften und Material musste man freilich mit den Hausanschlüssen bis zum Friedensschluß warten. Am 24.Januar 1922 wurde Atzenhausen erstmals elektrisch leuchtet (56). Während des Krieges wurden alle wehrfähigen Atzenhäuser eingezogen. Einer von ihnen, der Unteroffizier Ludwig Storch, erhielt als einziger Bewohner des Landkreises im Jahre 1916 das bulgarische National-Ehrenzeichen (57). Ein besonderes Missgeschick hatten drei Atzenhäuser, die in französische Gefangenschaft gerieten. Sie waren in verschiedenen Lagern und gehörten dennoch zufällig zu denen, die bis zuletzt auf ihre Heimkehr warten mussten (58). Nach dem Kriege baute Wilhelm Henkel als Ortsbrandmeister die Feuerwehr auf. Er sah seine Aufgabe darin, nicht nur die Wasserversorgung des Ortes zu sichern, sondern auch ein Löschwasserreservoir zu schaffen. Wie vielen Dörfern fand man auch hier die Lösung, das Angenehme mit dem Notwendigen zu verbinden. Unter weitgehender Eigenleistung der Ortsbewohner entstand ein Freibad von 225 qm Schwimmfläche, das am 11.Sepmber 1927 eingeweiht werden konnte (59). Es war das erste, dass im gesamten Landkreis Göttingen in einem Dorfe der Größenklasse Atzenhausens entstand. Die Durchführung der unaufschiebbaren Aufgaben, wie der oben genannten und des Anschlusses an die Elektrizitätsversorgung, machte die Inangriffnahme weiterer Projekte unmöglich, denn was erübrigt werden konnte, wurde 1930-31 in den Bau der neuen Schule gesteckt, der ohne die Hilfe der Provinz und des Landkreises für die arme Gemeinde unerschwinglich gewesen wäre. Der Entwicklung Atzenhausens kam ein glücklicher Zufall zu Hilfe. Im Jahre 1863 wählte die Gemeinde den Landwirt Fortmüller zum Bauermeister, einen jüngeren Mann, der 23 Jahre in seiner Stellung blieb. Dadurch war es möglich, die großen Umstellungen der folgenden Jahrzehnte langfristig vorzuplanen und dadurch ohne größere Schwierigkeiten durchzuführen. Mehrmals mussten die Rechte und Pflichten des Ortes sorgfältig zusammengestellt werden, um bei der Übertragung von Aufgaben des Amtes auf den Kreis keine Fehler zu begehen, die später nur mit großen Schwierigkeiten zu beseitigen gewesen wären. Fortmüller wurde hierin besonders tatkräftig von dem Beigeordneten Heinrich Elend unterstützt, der im Mai 1886 sein Nachfolger wurde (60). Beide Bauermeister gehörten einer Generation von Kommunalpolitikern an, die völlig unerwartet vor unlösbaren Schwierigkeiten standen. Die Verkoppelung hatte auch Atzenhausen, das freilich nie reich gewesen ist, zu einer armen Gemeinde gemacht, denn die Erträge der nunmehr aufgehobenen gemeinschaftlichen Besitzungen in der Feldmark, wie die der Wiesen, Weiden und Anger, des Waldes und der Obstbäume an den Straßen waren in die Gemeindekasse geflossen und so allen Bürgern zugute gekommen. Die Tatsache, dass es in der so viel zitierten "guten alten Zeit" so erstaunlich niedrige Steuern gegeben hatte, beruhte nur darauf, dass die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen aus den Erträgen des Eigenbesitzes flossen. Nach der Durchführung der Verkoppelung hatten die Gemeinden nur noch geringe Mittel zur Verfügung, denn die Steuern wurden ja nicht erhöht und erst der günstigere Verteilungsschlüssel, den das preußische Kommunalfinanzgesetz von 1894 brachte, sicherte ihnen die notwendigsten Mittel zur Durchführung der dringendsten Aufgaben. Gemeinden wie Atzenhausen, die sicher nur auf etwa 2.000 Mark im Jahre rechnen konnten, waren ohnehin darauf angewiesen, größere Beträge bei Sparkassen und Banken anzuborgen und von den Einnahmen zu verzinsen und zu amortisieren. Eine etwas größere Bewegungsfreiheit hat die Gemeindeverwaltung bis 1945 nie besessen. Elend konnte krankheitshalber sein Amt nur zwei Legislaturperioden hindurch versehen. Ihm folgte der Ackermann Karl Müller, der von 1896-1907 Bauermeister blieb. Dieser war der erste, der den Wählern ein Programm für die Arbeit der nächsten Jahre vorlegte. Der wichtigste Punkt war für ihn für die Zeit von 1902-1907 der Ausbau der Wege. Die Wahlberechtigten schlossen sich seiner Meinung an (61). Wir können in dieser Zeit feststellen, daß Spielregeln der parlamentarischen Demokratie stärker als früher die Gemeindeverwaltung prägten. Die Arbeit der Parteien erreichte das flache Land. Erstmals wurde in Atzenhausen am 4. Juni 1903 eine Wahlversammlung der nationalliberalen Partei und der Welfen in der Gastwirtschaft Storch abgehalten. Uns erscheint es heute etwas seltsam, dass zwei Parteien mit sehr unterschiedlichen Programmen eine gemeinsame Veranstaltung organisierten, aber im Sommer hatten die Landwirte, die ja noch keine Maschinen einsetzen konnten, so viel zu tun, dass sie unmöglich zwei Abende opfern konnten. Die Wahlversammlung verlief für beide Parteien erfolgreich (62). Am 16.Februar 1907 trat Müller zurück. Für ihn wurde der Stellmachermeister Georg Günther gewählt (63). Dieser war der erste Bauermeister Atzenhausens, der nicht hauptberuflich Landwirt war. Bereits im April löste ihn Friedrich Lüter als Bauermeister ab (64). Für diese Zeit liegen die ersten Wahlergebnisse für die Realgemeinde vor. In den Gemeindeausschuß, in den stets nur die Hälfte der Mitglieder auf drei Jahre gewählt wurde, entsandten 1912 die Wähler den Ackermann Heinrich Storch, den Gastwirt Karl Storch und den Waldarbeiter Karl Schreiber (65). Im nächsten Jahre wurde die andere Hälfte der Ausschussmitglieder neu gewählt, wobei der Ackermann Karl Utermöhlen und der Maurer Christian Henkel wieder- und der Waldarbeiter Wilhelm Perl neu gewählt wurden (66). Außer den Genannten arbeiteten der Ackermann Heinrich Elend I und der Arbeiter August Wasmuth in diesen Jahren im Ausschuss mit. Da der Erste Weltkrieg Wahlen unmöglich machte, blieben die vorstehend Genannten bis 1919 im Amt. Am 30.Oktober jenes Jahres wurden Ackermann Karl Utermöhlen, Arbeiter August Wasmuth, Ackermann Martin Pflöging und Maurer Christian Henkel in den Gemeindeausschuß gewählt, während die anderen ausschieden (67). An dieser Stelle muss auch dreier unermüdlicher Helfer der Gemeinde gedacht werden. Von 1879-1914 wirkte in Atzenhausen der Wegeaufseher Wieland, der die Straßen des Amtes Reinhausen und später des Landkreises Göttingen in jenem Bezirk betreute. Ohne seinen sachverständigen Rat wäre der Ausbau des Straßen- und Feldwegenetzes nicht denkbar gewesen. Die Kreisverwaltung und die Gemeinde ehrten ihn in einer Feierstunde anlässlich seines 25-jährigen Dienstjubiläums am 1. Oktober 1904 (68). Zu nennen ist auch die Hebamme Luise Günther, die von 1886 an fast genau vierzig Jahre tätig war und zu ihrem silbernen Dienstjubiläum besonders geehrt wurde (69). Unermüdlich war auch der in Obernjesa stationierte Gendarm Fuchs unterwegs. In den letzten Jahren vor dem Weltkriege hatte das Göttinger Kreisgebiet unter Zigeunern zu leiden, denen zahlreiche Viehdiebstähle zur Last gelegt wurden. Wir müssen freilich dabei in Rechnung stellen, dass zwischen nichtsesshaften Landfahrern aller Art und Zigeunern keinerlei Unterschied gemacht wurde. Es gelang Fuchs am Neuahrsmorgen 1912 bei Atzenhausen eine Landstreicherbande zu stellen und Festzunehmen, obwohl er seine Streife allein unternommen hatte (70). Nach der Revolution blieb Friedrich Lüter im Amt, erhielt nunmehr statt des alten Titels Bauermeister des Gemeindevorstehers und leitete bis 1930 die Geschicke Atzenhausens. Ihm folgte Albert Ziegler. Wie viele Kirchen der Mainzer Diözese ist auch die in Atzenhausen dem Hl. Petrus geweiht, was übrigens auf ein hohes Alter des Gotteshauses deutet, denn nach dem ersten Bischof Roms und großen Heidenapostel wurden im Hohen Mittelalter gern Kirchen benannt. Urkundlich wird die Kirche erstmals 1340 erwähnt. Der uns bereits bekannte Ministeriale Johannes von Atzenhausen schenkte in jenem Jahre das Patronat der Kirche dem Kloster Mariengarten (71). Da Johannes von Atzenhausen im Besitz des damals von Laien sehr begehrten Rechtes war, dürfen wir annehmen, dass seine Familie die Kirche gestiftet hat, denn einfachen Ministerialen, er nennt sich in der Urkunde selbst vasallus, also Lehnsmann, wurde ein Patronat nur selten verliehen. Erhard Kühlhorn schreibt in “Kirchen und Kapellen mit Wehranlage” über Atzenhausen: Wir können diese Urkunde aber als Beweis dafür anführen, dass die Herren von Atzenhausen wohlhabend gewesen sein müssen, denn sonst hätten sie es sich nicht leisten können, ein Recht, das ein so hohes soziales Ansehen verlieh, zu verschenken. Mariengarten hatte nunmehr auch für die Besetzung der Pfarrstelle in Atzenhausen zu sorgen. Eine Urkunde aus dem Jahre 1524 überliefert uns einen solchen Vorgang (72). Pfarrer Ludwig Feddelbogen war gestorben und die Äbtissin und der Konvent der Nonnen von Mariengarten präsentierten dem Offizial von Nörten, dem geistlichen Vertreter des Erzbischofs von Mainz im Göttinger Raume, Johann Freudendall, den der Offizial einführen musste, falls er die vorgeschriebenen Weihen besaß. Der erste evangelische Pfarrer ist erst 1588 mit Hermann Gericke nachweisbar. Vermutlich ist das Dorf durch die enge Verbindung mit Mariengarten länger katholisch geblieben. Von den ersten Pastoren kennen wir nur die Namen. Es waren von 1588-94 Hermann Gericke, 1594-98 Bernhard Kellius, 1598-1607 Johannes Götze, 1607-08 Simon Cagenus, 1608-14 Georg Arnold und 1614-27 Eberhard Feyerabend (73). Mit diesem reißt die lückenlose Tradition ab. Der Dreißigjährige Krieg trat sofort mit solcher Hätte und solchem Schrecken auf, daß Atzenhausen mit einem Schlage verarmte. Da die Gemeinde keine Pfarrstelle mehr unterhalten konnte, musste sie mit Meensen vereinigt werden. Für einige Jahre, zumindest von 1646-52, war Atzenhausen ein Filial von Hedemünden (74). Hierbei muss betont werden, dass die Kirchengemeinde nicht etwa alles verloren hatte. Der Grundbesitz war und blieb ihr Eigentum, aber während des Krieges blieben die Felder und Wiesen unbearbeitet. Auch das Wiesenland in Barlissen blieb die Jahrhunderte hindurch unangefochten im Besitz der Kirche (75). Man muss aber den in Meensen wirkenden Pfarrern das Zeugnis ausstellen, dass sie das Kirchenvermögen in Atzenhausen mit Umsicht und Geschick verwaltet haben. Sie konnten nämlich allmählich ein Kapital zusammenbringen, das 1822 zum Bau einer neuen, der heute stehenden Kirche genügte (76). Das alte Gotteshaus war so baufällig geworden, dass seine Instandsetzung nicht mehr lohnte. Im Jahre 1840 wurde Mollenfelde als Filial zu Atzenhausen gelegt (77). Das Pfarramt von Atzenhausen bestand also offiziell weiter, wurde aber von Meensen aus betreut. Nun erwies sich der Pfarrbezirk als zu groß. Man entschloss sich, Atzenhausen wieder zu besetzen. Von 1850-61 wirkte hier Philipp Meyer, 1861-77 Abert Soltmann, 1878-80 Ernst Vordemann, 1881-87 August Hörmann, 88-90 Johann Stoffregen, 1890-99 Karl Peix, 1900-1908 Wilhelm Ehlerng, dem von 1908-13 Hermann Fricke folgte (78). Dieser kam aus Idensen und entfaltete sehr bald eine rege Tätigkeit auf vielen Gebieten (79). Er war, wie es damals noch üblich war, Ortsschulinspektor und wurde 1912 vom Kreistag mit der Leitung des Ortsausschusses für Jugendpflege betraut (80). In diesem Bereich hat er sich große Verdienste um die Betreuung des auf dem Lande noch in den Kinderschuhen steckenden Sportes erworben. Als sein Nachfolger wurde Wilhelm van Nees, der bislang in Hameln tätig gewesen war, berufen (81). Dieser hat in der Kriegszeit rege bei der Betreuung der Verwundeten mitgewirkt. Besonders eifrig arbeitete er für die Mission. So hat er auf der 5. Tagung der allgemeinen hannoverschen Missionskonferenz in Göttingen am 8. Juli 1920 über das Thema "Missionsarbeit in der Heimat" gesprochen (82). Am 19.April 1921 wurde Pastor van Nees verabschiedet (83). Am 30. Oktober 1921 konnte Pastor Walter Mügge in sein Amt eingeführt werden (84). Die Gemeinde machte den vergeblichen Versuch, die Pfarrerbesoldung den in der Inflation schnell steigenden Preisen anzupassen (85). Sie stellte deshalb das Gehalt auf eine in Naturalien zu"zahlende" Werteinheit, die auf dem Roggen basierte um (86) und erst als es eine feste Währung gab, bekam Pastor Mügge wieder Geld. Aber auch in anderen Dingen war die "bargeldlose" Hilfe nötig. So haben die männlichen Gemeindemitglieder 1925 im freiwilligen Arbeitseinsatz den Friedhof renoviert (87). Die immer schwieriger werdende wirtschaftliche Lage zwang auch den Kirchenkreis Göttingen-Süd, zu dem Atzenhausen gehörte, zu strengen Sparmaßnahmen. Atzenhausen wurde von 1932-36 wiederum ein Filial von Meensen und kam dann zu Deiderode. Pastor Mügge betreute die Gemeinde aber weiterhin. Nach seiner Emeritierung veröffentlichte er mehrere Artikel zur Geschichte von Atzenhausen. Er setzte diese Tätigkeit s kurz vor seinem Tode fort (88). Dadurch wurden erstmals größere Leserkreise auf die bewegte Geschichte des Dorfes aufmerksam gemacht. |
|||
|
Zit. nach: Dr. Günther Meinhardt: Chronik der Gemeinde Rosdorf und ihrer Ortschaften. Bd. 1. Gudensberg-Gleichen. |
|
[Chronik Atzenhausen] [Atzenhausen bis 1933] [1933 bis 1985] |